

«Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.» Das heisst es im Märchen von den jungen Leuten, denen nach viel Müh und Pein verdienter Wohlstand und Familienglück winken. Wie aber steht es in dieser Literaturgattung mit der älteren Generation? Geschichten vom Altsein bei den Brüdern Grimm.
VON BRIGITTE BOOTHE
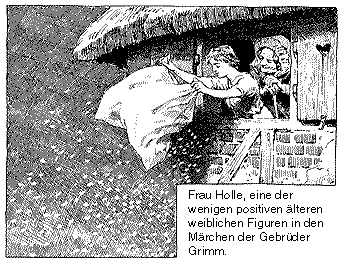 |
In den Märchen der Brüder Grimm sind Figuren, die sich durch hohes Lebensalter auszeichnen, zahlreich vertreten. In immerhin 58 von insgesamt zweihundert Märchen kommt das Alter vor. Dabei gibt es zu etwa sechzig Prozent weibliche, zu ungefähr vierzig Prozent männliche Protagonisten. Was die Zuweisung bestimmter Rollen und Funktionen angeht, so findet man eindrucksvoll klare Verhältnisse. Die männlichen Protagonisten treten überwiegend in wohlwollender und unterstützender Vater- und Helferfunktion auf.
Dem steht eine ebenso grosse Zahl – nämlich ein rundes Dutzend – weiblicher Figuren gegenüber, die sich durch die positive Rolle der Helferin, Wohltäterin und Spenderin auszeichnen. Zu diesen positiven weiblichen Helfergestalten zählt an prominenter Stelle die mächtige und imposante Herrscherfigur der Frau Holle (Kinder- und Hausmärchen, KHM, Nr. 150). Sie ist nicht jedem gewogen: Über die Goldmarie schüttet sie Taler aus, über die Pechmarie eine Ladung Pech.
Frau Holle steht an sehr zentraler Stelle. Sonst aber ragen die bejahrten Helfer und Helferinnen, Wohltäter und Wohltäterinnen in den einzelnen Geschichten wenig heraus. Sie bleiben als Erblasser, als Leute, die substantielle Güter vermachen und verschenken können – das ist der charakteristische männliche Fall –, oder als beratende Solidargenossin oder Vermittlerin – das ist der charakteristische weibliche Fall – eher im Hintergrund.
Vital und drastisch hingegen agieren die bösen Alten auf der Märchenbühne. Und die bösen Alten, die sind weiblichen Geschlechts. Sie treten meistens, immerhin dreizehnmal, als Mörderin, Schädigerin und Ausbeuterin auf, sechsmal als böse Heirats- und Eheintrigantin; schliesslich erscheinen sie zweimal – in «Hänsel und Gretel» (KMH, Nr. 15) und in «Fundevogel» (KMH, Nr. 51) – als Menschenfresserin.
Die mächtigen Alten
Die guten und die bösen alten Frauen sind gewöhnlich tatenlustig, etwas undurchsichtig und latent oder offen gefährlich. Sie verfügen über Einfluss, Reichtum und Kontrollmacht. Wenn sie den Sympathieträgern des Märchens gewogen sind, stellen sie all dies in den Dienst ihrer Schützlinge; sind sie böse, dann sind sie tückisch, schlau, falsch, manipulativ, raffgierig und gefrässig. Freiwillig treten die Bösen nie von der Bühne des Lebens, man muss sie kaltstellen; und das ist gewöhnlich ein ordentliches Stück Arbeit.
Blickt man auf die 58 Geschichten, so gibt es für die meis-ten eine übergreifende Gemeinsamkeit. Die Alten, die da auf ihrem Bauernhof sitzen oder in ihrem Königsschloss oder in ihrer Waldhütte, sind Ressourcenträger, Inhaber begehrenswerter Güter materieller oder nichtmaterieller Art. Es sind mächtige Alte.
Sie lassen sich zwei Gruppen zuteilen. Die erste Gruppe zeichnet sich dadurch aus, dass die alten Männer und Frauen, die ihr angehören, willens oder geneigt sind, ihre Besitztümer und ihre Ressourcen weiterzugeben. Sie stehen in sozialen Bindungen und sind daran interessiert, den Jüngeren Platz zu machen, statt für sich selbst Ansprüche zu stellen. Dieser Gruppe steht eine zweite gegenüber, die keineswegs den Jüngeren Platz machen will. Das sind die wilden Frauen. Sie sind nicht verführend und nicht sympathisch, aber gefährlich und frei. Sie sind moralisch völlig ungebunden und stecken voll zupackender Vitalität. Sie kennen kein Liebesinteresse. Wer ihren Weg kreuzt, verliert seine Autonomie. Will er sie zurückgewinnen, muss er – oder sie – kämpfen, diese überlisten oder liquidieren. Das ist in der Märchendramaturgie legitim, da diese Widersacherinnen vor Gewalt und Mord nicht zurückschrecken. So kommt die Leserschaft in den Genuss der lustvollen Attacke gegen eine beherrschende weibliche Schicksalsmacht.
Wir sehen bei den mächtigen Alten, den wohlwollenden wie den feindseligen, den männlichen wie den weiblichen, den Kampf um die Bestimmungs- und Verteilungsmacht. Ein Märchen endet gut, wenn das Alter zurücktritt, freiwillig oder erzwungen, und wenn die Ressourcen der Alten in die Verfügung der jüngeren Begünstigten gelangen. Das Prinzip heisst also: Abdankung. Die Alten im Märchen sind dazu da, dass sie das Geheimnis von Macht und Besitz weitergeben und selbst zurücktreten.
Tabubrüche
Ein überaus ernüchterndes Ergebnis einer Expedition in die Welt des Wunderbaren. Aber das Faszinierende an der «Gattung Grimm» (Andre Jolles) ist ja gerade, dass die Märchendramaturgie dem Illusionären keinen Raum gibt. Vielmehr artikulieren die Märchen zentrale Wünsche, aggressiver wie freundlicher Natur, und sie sind diesbezüglich äusserst stimmig. Das heisst unter anderem, kaum überraschend: Die 58 Geschichten sprechen nicht den Alten, sondern den Jungen aus dem Herzen.
Es gibt keine Märchen für Alte. Stimmt das? Gewiss. Das stimmt. Auch für drei weitere Beispiele, bei denen die Ausgrenzungs- und Liquidationslust sehr deutlich wird, aber auf neue Art. In keinem dieser drei Fälle handelt es sich um Märchen im üblichen Sinn. Allen Geschichten ist gemeinsam, dass nunmehr die Hinfälligkeit und Bedürftigkeit des Alters thematisch wird.
Da ist der «undankbare Sohn» (KHM, Nr. 145). Er will zusammen mit seiner Frau ein gebratenes Huhn verzehren, dem alten Vater aber, der hinzukommt, nichts abgeben. Da verwandelt sich die Speise in eine grosse Kröte, «die sprang ihm ins Angesicht und sass da und ging nicht wieder weg… Und die Kröte musste der undankbare Sohn alle Tage füttern, sonst frass sie ihm aus seinem Angesicht; und also ging er ohne Ruhe in der Welt hin und her.» Ein erschreckendes Ende. Die vorenthaltene Fürsorge dem Vater gegenüber hat das Ausmass eines Frevels, einer furchtbaren Verfehlung, die von numinosen Mächten grausam geahndet wird, geahndet durch ein zerfressendes Schandmal, der Schwarzen Spinne Gotthelfs vergleichbar, das dem Antlitz die Züge des Menschlichen raubt. – Ist das nicht ein bisschen viel für ein vorenthaltenes Huhn?
O doch, ganz entschieden. Aber was uns hier mit dem «schrecklichen Strafwunder» (Peter von Matt) begegnet, ist nicht einfach der menschliche Konflikt zwischen dem Eigennutz des aktuell Starken und dem Fürsorgeanspruch des schwachen Angehörigen. Denn es ist ja das grausame Bild vom krötenbesetzten Gesicht, das die Szene beherrscht. Was den Sohn hier trifft, ist etwas, das dem Bereich der kindlichen und der archaischen Vorstellungswelt angehört. Es geht um jenes ursprungshafte Grauen, das Kinder einst kannten, wenn sie heimlich an weihevollen Orten ein verbotenes Wort dachten oder wenn es sie durchfuhr, plötzlich einer verehrten Person etwas Böses zu wünschen. – Wenn man zur Strafe vom Blitz erschlagen würde?
Das ursprungshafte Grauen antwortet nicht auf die Herausforderung einer menschlichen Begegnung, sondern auf die Erprobung eigenen Freiheitswillens angesichts eines vorgestellten Bemächtigungsanspruchs, der dem Individuum auf den Leib rückt und gleichzeitig undurchschaubar bleibt. Das heisst: Nicht der alte Vater will sich seines «undankbaren Sohnes» bemächtigen. Vielmehr verfügt jener Alte in den Augen des – vielleicht ganz jungen – Lesers über gewaltige und mächtige numinose Fürsprecher, die, wenn sie es wollen, gnadenlos zermalmen, wer ihren Zorn erregt. So tritt der Alte gar nicht als Individuum oder Person auf, sondern transzendiert schaurig zur unpersönlichen Figur, die durch ein Tabu gleichsam geheiligt und unantastbar geworden ist.
Dass dies so zu lesen ist, wird deutlich an einer zweiten Geschichte, die der Gewalt der Tabuierung unverfroren, gleichsam blasphemisch, entgegentritt. «Die alte Bettelfrau» (KHM, Nr. 150) lockt uns zunächst in eine freundliche Szenerie herzwärmender jugendlicher Fürsorglichkeit. Ein Junge lädt die alte Frau ein, sich am offenen Feuer zu wärmen; da fangen die zerrissenen Kleider der armen frierenden Bettlerin Feuer, und sie merkt es nicht. «Der Junge stand und sah das, er hätt’s doch löschen sollen? Nicht wahr, er hätte löschen sollen?» Das Ende der Geschichte lässt Untergang oder Rettung vollkommen in der Schwebe. Vielmehr heisst es hypothetisch und voll frecher Ironie: «… dann hätte er alles Wasser in seinem Leibe zu den Augen herausweinen sollen, das hätte so zwei hübsche Bächlein gegeben, zu löschen.»
Man glaubt, nicht recht gelesen zu haben. Der Junge amüsiert sich – und unerhörterweise mit ihm der Erzähler – über das Unglück, das der alten Frau entsetzlich zu widerfahren droht. Die Geschichte lässt uns moralisch vollkommen im Stich, und wir nehmen es ihr übel. Sie ist unverträglich und unverfroren. – Aber auch nicht mehr als das. Sie fordert nicht auf zur Hexenverbrennung noch zur beschaulichen Lust an derselben, denn das Geschehen erfährt keinerlei Legitimation oder Plausiblisierung. Es handelt sich – vor der Kontrastfolie des «undankbaren Sohnes» – um eine Befreiungsgeschichte. Der Glaube an die numinose Macht, die das Bild des Alters mit Scheu und Schauder verband, wird im Tabubruch attackiert.
Es heisst: der Alte oder ich – die Alte oder ich. Einer muss dran glauben. In der Tabu-Geschichte muss der Sohn dran glauben. Sein Menschliches zerfällt. Er verliert seinen Platz in der Welt. Als ein Gebrandmarkter geht er «ohne Ruhe in der Welt hin und her». In der Befreiungsgeschichte steht der Junge fest und sicher, und die Alte muss dran glauben.
Da treffen wir auf eine ganz anders angelegte Geschichte, eine lehrhafte und mahnende diesmal. Der «alte Grossvater» ist Titelfigur der berühmten Erzählung «Der alte Grossvater und sein Enkel» (KHM, Nr. 78). Der Grossvater ist angewiesen auf die Fürsorge seines Sohnes und dessen Familie. Die Essmanieren des alten Mannes lassen nach. Von seinem Anblick abgestossen verweist man ihn mit plumpem Holzgeschirr und knappen Rationen weitab vom Tisch hinter den Ofen. Da sitzt er traurig und sieht «betrübt nach dem Tisch». Der kleine Enkel aber trifft Anstalten, ein Holzgeschirr zu zimmern und antwortet auf die väterliche Frage, was er da tue: «… daraus sollen Vater und Mutter essen, wenn ich gross bin.» – «Da sahen sich Mann und Frau eine Weile an, fingen endlich an zu weinen, holten sofort den alten Grossvater an den Tisch und liessen ihn von nun an immer mitessen, sagten auch nichts, wenn er ein wenig verschüttete.»
Die Versorgung des bedürftigen Alters erscheint als saure Pflicht. Man würde sich ihrer gern entledigen. Erst die Konfronta- tion mit der Aussicht, selbst einmal zu werden wie der alte Mann und behandelt zu werden wie er, führt zu innerer Erschütterung, Trauer und liebevollem Verständnis bei Sohn und Schwiegertochter. Nicht Einschüchterung und Tabuierung sind wirksam, sondern Kräfte der Begegnung: Empathie und Identifikation, Trauer und Reue. Das Er oder Ich ist überwunden. «Der Stoff» dieser in der gesamten Weltliteratur breit tradierten Geschichte ist, wie von Matt im Buch «Verkommene Söhne, missratene Töchter» schreibt, «mit einer der schmerzhaftesten Krisen der menschlichen Selbstwerdung verknüpft, und zwar nicht nur im Kontext sozialer Regeln, sondern auch im Bereich des Biologisch-Physiologischen: dem existentiellen Abschied von den Eltern». Trennung und Verbindung, Abstossung und Geborgenheitssehnsucht werden in der kleinen Lehrgeschichte psychologisch und auf der Ebene der direkten menschlichen Begegnung ausgestaltet.
Von der Not ins Glück
Aber das ist nicht das Ende vom Lied. Da ist noch eine Geschichte, eine schwankhafte diesmal, vom Alter. Und wieder geht es um Ausstossung, Marginalisierung und Liquidation. Aber noch einmal in neuer Wendung. Vier dienstbare Geister, vier willige Arbeiter haben ausgedient und sich von ihrer Herrschaft davongestohlen, ehe es ihnen an den Kragen geht. Sie wollen eigentlich als musikalisches Quartett in Bremen auftreten, erobern sich aber unterwegs in gemeinschaftlicher List ein wohlausgestattetes Räuberhaus als dauernde Wohnstatt.
«Die Bremer Stadtmusikanten» (KHM, Nr. 27) bilden eine Schicksalsgemeinschaft Bedrohter und Marginalisierter. Es geht in ihnen gut in dieser Solidargruppe: «Von nun an getrauten sich die Räuber nicht wieder in das Haus, den vier Bremer Musikanten gefiel’s aber so wohl darin, dass sie nicht wieder heraus wollten.» Esel, Hund, Katze und Hahn sind hier der sozialen Bewertung nach Narrenfiguren. Ihrer Funktionalität ledig gelten sie nichts mehr in der Welt. Aber der Esel ist nicht dumm, der Hund kein Don Quichotte, die Katze kein Schildbürger; nein, der Leser lacht nicht über die Tiere, er lacht mit ihnen. Die Geschichte ist nicht lustig, weil die Tiere so komisch sind. Sie ist lustig, weil die Tiere – auch wenn die Geschichte simpel und kindlich ist – so gezeichnet werden, als spielten sie mit dem Närrischen, Komischen und Greulichen und nutzten es listig und selbstironisch für die Eroberung ihrer neuen Bleibe, die, frei von Kontrolle und Dienstbarkeit, von Anstand und Ehrbarkeit, soviel genussvolle Vitalität und Behagen schafft.
Vielleicht ist diese eine Geschichte bei näherer Betrachtung doch ein Märchen vom Alter, ein schwankhaftes, aber doch eines mit wirklichem Happy-End für die vier Sympathieträger, die in einer wirklichen Notlage ausgezogen waren, ihr Glück zu machen. Und was ist ihre Notlage? Was ist ihr Glück?
Die Not ist: Marginalisierung, in der existentiellen Bedeutung dieses Wortes. Entwertung der Person, Missachtung, Ausstossung, Vernichtung. Das Glück ist: die Solidarerfahrung und die Verwandlung des marginalen Ortes in ein Paradies der Freiheit und des Genusses. Ein besonderes Vergnügen an der Erzählung ist: wie sich die tragische Vorstellung von der persönlichen Vernichtung und Entwertung in der Leichtigkeit der listigen Narrenmaskerade aufhebt. Ein Kinderspiel?
LITERATUR
Brüder Grimm: Kinder- und Hausmärchen. (KHM). Hrsg. H. Rölleke nach der Ausgabe letzter Hand von 1857. Bände I-III. Reclam Verlag, Stuttgart 1980
Andre Jolles: Einfache Formen. Legende, Sage, Mythe, Rätsel, Spruch, Kasus, Memorabile, Märchen, Witz. Niemeyer, Tübingen 1974 (Original 1930).
Peter von Matt: Verkommene Söhne, missratene Töchter. Familiendesaster in der Literatur. Hanser Verlag, München 1995.
Dr. Brigitte Boothe ist ordentliche Professorin für Klinische Psychologie an der Universität Zürich.
unipressedienst –
Pressestelle der Universität Zürich
Nicolas Jene (upd@zuv.unizh.ch)
Last update: 17.04.99